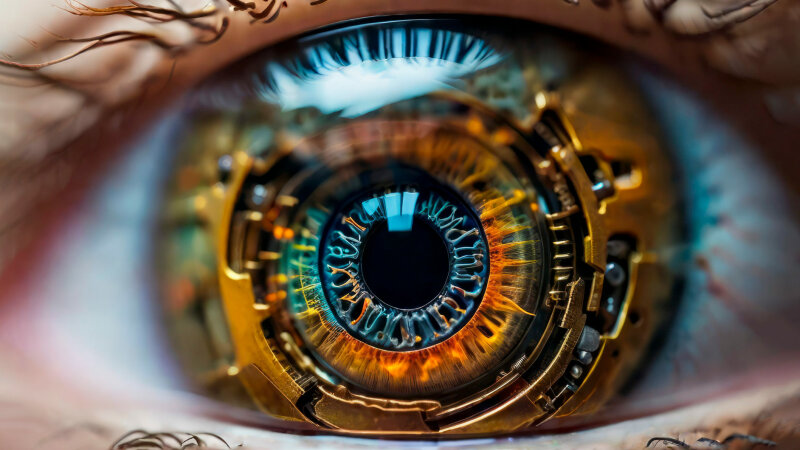Zum etablierten Forum der Staatlichen Führungsakademie - bisher ein jährlicher Austausch vor allem der Behördenleiter - waren erstmals alle Mitarbeitenden des Ressorts eingeladen.

FüAk-Präsident Werner Eberl
Wir wollen das Thema breit angehen.
FüAk-Präsident Werner Eberl sprach in seiner Begrüßung von einer Auftaktveranstaltung, mit der man möglichst viele Beschäftigte auf den gleichen Stand in Sachen KI bringen wolle. Etwa 100 Teilnehmende waren in die Meistersingerhalle nach Nürnberg gekommen, gut 300 hatten sich online zugeschaltet und stellten mittels Chatfunktion immer wieder ihre Fragen an die Fachleute.
Der aktuelle Stand zu den Entwicklungen und Plänen für das Ressort in Sachen KI sorgte für Klarheit. Dr. Maximilian Wohlgschaft, CIO im Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, stimmte die Zuhörer auf den Fahrplan ein: "Wir wollen es zulassen." Wichtig sei ihm, dass KI weder die "Zauberlösung" für alle Probleme biete, noch ein Grund für Ängste bei den Beschäftigten sein dürfe. Vielmehr sei sie der notwendige nächste Schritt in der Digitalisierung.
Dieses mächtige Instrument sinnvoll zu nutzen, im richtigen Tempo und an den richtigen Stellen, sei eine Herausforderung. Sie müsse bei den Führungskräften beginnen, und zwar mit einer offenen Einstellung. Die Verwaltung müsse sich Schritt für Schritt auf den Weg machen und mit internen Ressourcen Digitalisierung und KI ernsthaft angehen. Die geplante Kompetenzstelle KI an der FüAk solle dabei helfen, diese Instrumente wohlüberlegt einzuführen, Daten und Prozesse vorzubereiten und sinnvolle Anwendungen umzusetzen.
Technisch in die Tiefe ging es bei Dr. Chris Richter von der Digitalagentur byte, zugeschaltet per Videokonferenz. Staatsministerin Michaela Kaniber übernahm unfreiwillig die Vorstellung seiner Person - in einem Deep Fake-Video, erstellt "in vier Minuten", so Richter, mithilfe eines Portraitfotos der Ministerin und Social-Media-Videos. Richters Rat an die Forumsteilnehmenden: Alles, was sie sehen, hinterfragen. Damit meint er auch die Ergebnisse von Anwendungen wie ChatGPT, die rein auf Wahrscheinlichkeiten beruhen. "KI wirkt magisch, ist aber keine Magie, sondern Handwerk", so Richter.
Der Anwendungsfall entscheide über Genauigkeitsmetrik, - anforderungen, das Training und die Update-Frequenz einer KI-Anwendung. Für regelbasierte und mathematisch definierbare Prozesse sei auch weiterhin keine KI erforderlich, so Richter. Im Gepäck hatte er ein plakatives Anwendungsbeispiel, dass KI nicht immer smart ist: ChatGPT hält 9,11 für größer als 9,9. Sein Fazit: KI sei nicht sofort die Lösung für alles, doch für automatisierte Aufgaben könnten die Stärken von KI zum Tragen kommen, etwa die Bilderkennung zur Überwachung der Pflanzengesundheit oder die Spracherkennung für die digitale Beratung.
Leon Lukas, Leiter des KI-Kompetenzzentrums der Landeshauptstadt München, ist mit seinem Team Ansprechpartner für die rund 40.000 Beschäftigte der Stadt, bietet Schulungen, entwickelt Services und sorgt für die notwendige Architektur - alles in Sachen KI. Er stellte eine KI-Suche für den Bürgerservice vor, die Anliegen versteht, auch wenn der Benutzer den konkreten Fachbegriff nicht eingegeben hat. Im konkreten Fall werde künftig die KI dabei mithelfen, solche Bürgeranfragen richtig zuzuordnen und passende Ergebnisse aus dem großen Informationsangebot vorzuschlagen.
Mit MUC-GPT, einem Open-Source-Werkzeug zur generativen Texterstellung, geht München einen eigenen Weg und verhindert so, dass die Mitarbeiter andere Online-Tools nutzen, bei denen zum Beispiel Daten nicht geschützt sind. Stolz verwies er auf die bis zu 4000 Anfragen täglich der rund 5300 Benutzer, die zu 85 Prozent zufrieden mit dieser Anwendung sind.
das KI-Talent der Mitarbeitenden,
die technische Infrastruktur,
die Anwendungsfälle und
der Steuerungsrahmen mit Datenschutz, IT-Sicherheit und Richtlinien.
Dr. Alexander Malcharek, CIO 1 am Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, sieht die generative KI, insbesondere komplexe Sprachverarbeitungsmodelle, als "Chance für die öffentliche Verwaltung, ihre Aufgaben effizienter zu erfüllen". Bei der Verwendung in der Verwaltung gilt es, mögliche Rechtsverletzungen in Datenschutz, Urheberrecht etc. zu vermeiden und Informationssicherheit und wirtschaftlichen Einsatz zu gewährleisten.
Chatbot
Übersetzer
Multitool zur Sprachüberarbeitung
Zusammenfassungstool für PDF- und DOCX-Dokumente
Mindmap
Bildgenerator
Voraussetzung für die Nutzung dieser BayernKI ist die Bestätigung der Datenschutzanweisungen. In Planung sind laut Malcharek zudem der Aufbau der Stabstelle KI an der FüAk und das Sammeln von Erfahrung, insbesondere in Softwareentwicklung sowie Pressearbeit. Für alle Mitarbeitenden soll Ende des Jahres noch ein E-Learning-Kurs auf der BayLern-Plattform rund um KI starten. Zudem sollen eigene spezifische KI-Assistenten für bestimmte Fachbereiche in Zusammenarbeit mit dem IT-DLZ entstehen.
Professorin Lena Kästner vom Lehrstuhl für Philosophie, Informatik und Künstliche Intelligenz an der Universität Bayreuth bereicherte die Debatte mit Denkanstößen zu den Risiken moderner KI. Man müsse sich der moralisch-ethischen Gefahren bewusst sein.
Beispielsweise könne diese bei einem unkontrollierten Einsatz unvorhergesehene, teils katastrophale Fehler erzeugen.
Nicht zu unterschätzen sei das Problem der Verzerrungen (Bias) in der Blackbox KI, die zu diskriminierenden Entscheidungen führen können und durch den blinden Einsatz solcher Systeme verstärkt werden.
Konkrete Auswirkungen auf die Lehre (Hausarbeiten, Abschlussarbeiten), das Rechtssystem (standardisierte Urteilskonfiguratoren), das Vertrauen in Bilder und Videos (Deepfakes) beeinflussten schon jetzt die Gesellschaft.
Hinzu komme die "Komfortfalle" KI, die uns das Denken gleich mit abnehme.
Utopie oder Dystopie?
"Wollen wir unsere Sozialkontakte wirklich durch Künstliche Intelligenz ersetzen?", stimmte sie die Teilnehmenden nachdenklich. Der Kampf um die wirtschaftliche und politische Macht der Zukunft sei in vollem Gange, doch die Folgen für globale Gerechtigkeit und Klima würden größtenteils ausgeblendet. Vor diesem Hintergrund müsse man sich die Frage stellen, was übrig bleibe von den Chancen der KI.
Als Lösungsstrategien nennt Kästner transparente KI-Systeme, die zertifiziert und auf Zuverlässigkeit geprüft sind, außerdem eine verbindliche Regulierung oder auch eine - vermutlich nicht durchsetzbare - Entwicklungspause. Es liege weiterhin im Ermessensspielraum der Anwendenden, Augenmaß zu bewahren, nicht "denkfaul" zu werden und weiter auf die eigenen kognitiven Ressourcen zu setzen.
Professor Patrick Mäder, vom Lehrstuhl 'Data-intensive Systems and Visualization dAI.SY' an der Technischen Universität Ilmenau gab einen Einblick in die KI-basierte Kennartenbestimmung im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union - in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Kompetenzzentrum Flächenmonitoring (ZKF) an der FüAk. Dieses praktische Anwendungsszenario ist auch ein Beispiel für positiven Nutzen von KI, mit deren Hilfe man die GAP-Ziele zur Steigerung der Artenvielfalt überwachen könne.
In der bayerischen Variante, der FAL-BY-App, bestimmen Landwirtinnen und Landwirte bis zu 36 Pflanzenarten auf Grünland. Mäder beeindruckte mit den Zahlen für 2024: 1,9 Millionen ausgewertete Fotos aus dem gesamten Pflanzenspektrum, bei einer überragenden Trefferquote von über 99 Prozent. Herausfordernd sei in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung der zusätzliche Aufwand durch Sicherheitsprüfungen und -standards. Doch das hat sich gelohnt, denn ohne diese Hilfe wäre die Auswertung für die Verwaltung nicht möglich gewesen. Weitere GAP-Prozesse ließen sich eventuell sinnvoll unterstützen.
Erfolgsgeschichte Flora Incognita
In deutlich größerem Umfang und mit einer tieflernenden KI arbeitet die App Flora Incognita zur Pflanzenbestimmung, ein weiteres Projekt Mäders in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut. Sie umfasst über 34.000 Pflanzenarten, ist mittlerweile auf rund 12 Millionen Endgeräten installiert und schneidet in puncto Bestimmungsgenauigkeit sehr gut ab. Bis zu 850.000 Bestimmungsanfragen laufen pro Tag ein und werden auf den Servern in Ilmenau verarbeitet.
Flora Incognita externer LinkKI-Assistenten in der Staatskanzlei
Wieso die KI-Anwendung Copilot keine bekannten Persönlichkeiten erkennt, erklärte Franziska Kurz von der Staatskanzlei, die dort Teil eines Pilotprojekts für KI-Assistenten in der Anwendung ist. Mit dabei hatte sie außerdem Tipps für das Prompting, also die Eingabe in ein komplexes Sprachverarbeitungsmodell. Hier sei es zum Beispiel auch wichtig, wertschätzende und freundliche Frage zu stellen, Feedback zu geben und einzufordern. Sie berichtete vom konkreten Einsatz, etwa für Recherchen, Briefe, Laudationen oder in der Bilderstellung.
KI-Assistenten in der Bildung
Professorin Elfriede Berger, Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien, sprach eine große Fülle von Anwendungen an, die sie in der Lehre verwendet und auch ihren Schülern ans Herz legt - von der Live-Übersetzung für internationale Treffen über digitale Sprachlabore bis zum Nachhilfe-Tool. Der Ansatz der Hochschule ist es, positiven Nutzen aus den KI-Instrumenten zu ziehen und die Studierenden im Umgang zu befähigen.

KI-Assistenten in der Öffentlichkeitsarbeit
Ebenfalls um Anwendungsmöglichkeiten, diesmal in der Öffentlichkeitsarbeit, ging es bei Bastian Pohl von der Firma Agro-Kontakt. Geeignet sei KI für die Ideenfindung, Recherche, visuelle Ausarbeitung und auditive Ausarbeitung. Für die Prompts empfiehlt er neben der konkreten Aufgabe weitere Angaben zu Kontext, Adressat, Beispiele, das gewünschte Format und die Tonalität mit anzugeben.
Energiehunger und Ressourcenverschwendung
Zeit für Fragen nahmen sich alle Referenten vor Ort in der Schlussrunde. So ging es zum Beispiel noch mal um die Problematik, wie KI unter dem Gesichtspunkt von Energie- und Ressourcenschutz überhaupt ethisch-moralisch betrieben werden kann. Professorin Kästner betonte, dass diese Fragen immer im globalen Kontext betrachtet werden müssten, denn jeder wolle im Wettbewerb bestehen. Es brauche daher eine gemeinsame Policy als Weltgemeinschaft, die es allerdings noch nicht mal in der EU gäbe. Dr. Wohlgschaft stimmte zu, dass über den Energieverbrauch meistens nicht nachgedacht werde und der Nutzen häufig vor der Moral komme. Auch das private Nutzerverhalten mit Online-Dauerkonsum verstärke die Trends.

Funktionen in der BayernKI
Auf den Wunsch nach einer personalisierten Version der BayernKI ging Dr. Malcharek ein. Er begründete den bewussten Verzicht darauf mit der Vorgabe, keine einzelnen personenbezogenen Daten an Microsoft zu übermitteln. In der jetzigen Form promptet quasi "der Freistaat", keine Einzelperson. Ob dies mittelfristig ermöglicht werde, sei momentan nicht absehbar. Auch ob weitere Dateiformate nach der Betaversion für den Import zugelassen werden, lasse sich momentan nicht sagen. Man nehme die Wünsche auf, müsse momentan aber die Realitäten akzeptieren.

KI und Leistungsnachweise in der Bildung
Ein großes Thema bei allen Lehrenden ist die Auswirkung von KI auf die Leistungsnachweise - mit der jede Einrichtung anders umgeht. Die Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien legt deshalb den Schwerpunkt auf den empirischen Teil einer Abschlussarbeit. Prompts sollen aus Quellen in den Arbeiten angegeben werden. An der Universität Bayreuth probiert man beispielsweise flexiblere Prüfungsverfahren und zusätzliche mündliche Prüfungen aus, die jedoch arbeitsintensiver für die Lehrenden sind. Auch an der TU Ilmenau verstärkt man die mündlichen Tests live im Hörsaal. Generell lasse sich nicht nachweisen, ob Hilfsmittel aus der KI angewendet wurden.
Fazit
"Gehen wir es gemeinsam an", war dann der abschließende Wunsch von FüAk-Präsident Eberl. Er dankte "am Ende eines gelungenen Tages" allen Experten, CIO, Teilnehmern vor Ort und online sowie allen an der Organisation und Umsetzung Beteiligten.
Vorträge und Unterlagen
Sie konnten nicht beim FüAk-Forum dabei sein und möchten sich genauer informieren? Beschäftigte des Ressorts finden Aufzeichnungen der Vorträge und weitere Unterlagen in Kürze im Mitarbeiterportal:
Mitarbeiterportal - nur für Beschäftigte aufrufbar externer Link